Abfolge beim schlaff bewehrten Biegebauteil
- Die Bewehrung wird schlaff, ohne Spannung in die Schalung eingebaut.
- Ab dem Ausschalen muss der Biegebauteil sein Eigengewicht tragen. Er biegt sich durch. Es entsteht das Kräftepaar Biegedruck und Biegezug.
- Erhöht sich die Last, so vergrößert sich die Durchbiegung. Beton kann nur begrenzt Zugkräfte aufnehmen. Er bekommt an der Zugseite Risse. Erst dadurch wird der Stahl mehr gedehnt, er nimmt höhere Zugkräfte auf und er wird besser ausgenützt.
- In der schlaffen Bewehrung entsteht also erst die Zugkraft über die Verformung des Bauteils. Um diese Verformung, Durchbiegung auszugleichen, werden Biegebauteile vor dem Betonieren überhöht.

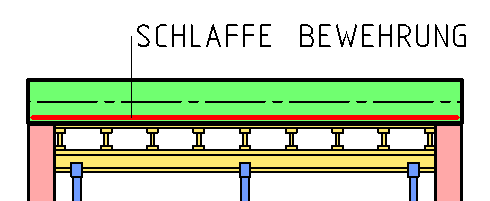 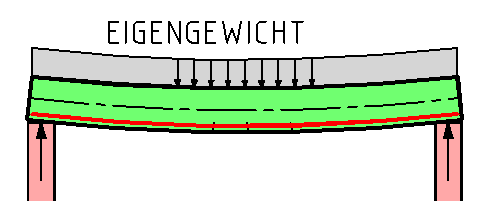
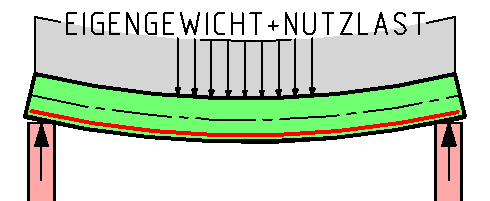

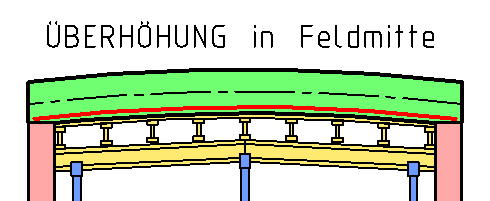
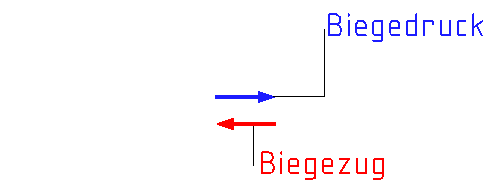 |
Woher bekommt man die erforderliche Überhöhung?
|
Aus diesen Zusammenhängen leitet sich ab: Biegebeanspruchte Stahlbetonbauteile bekommen in den Zugbereichen feine Risse.
Nur in Sonderfällen wird der Stahlbeton für den Zustand I, rissefrei bemessen. Der Stahl bekommt dann lediglich einen kleinen Teil der Zugkräfte die er eigentlich aufnehmen könnte. Das führt zu stärkeren Querschnitten und höheren Stahlverbrauch.
|
Querkraftrisse verlaufen von den Auflagern weg, meist unter 45° nach oben. Damit der Rostschutz und auch die Dichtheit nicht gefährdet werden, dürfen die Risse nicht zu groß werden. |
Einfeldbalken mit Kragarm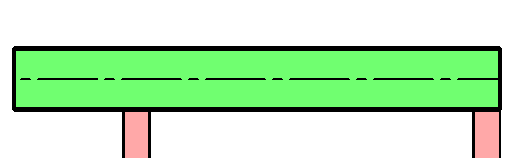
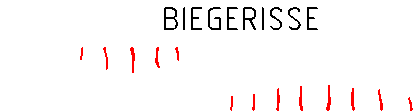


 |